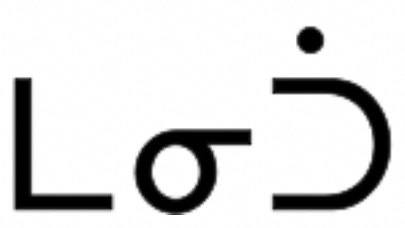Geschlafen wie die Murmeltierchen, wachen wir zum Murmeltiergepiepse wieder auf. Die kleinen Racker haben diesen klitzekleinen Erdteil fest in der Hand, beziehungsweise fest in ihren kleinen Pfötchen. Sie sind es, die hier den Ton angeben. Pieppiep. Den ganzen Tag. Pieppieppiep.
Piep sagen die stehenden Hörnchen, die Beobachter. Sie checken ganz genau, wer sich nähert, wer Knabberzeug in Petto hat und wer wie lange im Bad braucht. Lebende Warnmelder und sicherlich auch ganz ausgezeichnete Waschweiber; es ist ein Leichtes sich vorstellen, wie hier über vorbeieiernde Camper gelästert wird. Im Chipmunkuniversum.
Die kleinen Resteverwerter fressen alles, was nicht niet- und nagelfest ist – Blümchen, Gras, Chouchous Mikrophon, am allerliebsten aber Camperrestbestände, wahllos und vollkommen angstbefreit bei der Nahrungsbeschaffung.
Es ist ein ausgeklügeltes Spiel, das der Beobachter ansagt:
Hey Leute. Guckt mal alle schnell. Die zwei ungewaschenen Langhaarigen in dem weißen, kleinen Auto, die schnappen wir uns jetzt. Die sind so lahm und tierlieb, die werden sich nicht wehren. Alle zusammen, bei drei. Piep piep piep: Attacke.
Die Absprache läuft zügig und reibungslos. Nicht lange, und die ersten Kompagnions hüpfen über unsere Füße. Sie klauen die Kekse, sie werfen die Tasse um, um an den Kaffee zu kommen, sie trinken aus unserem portablen Kühlschrank – der zugegebenermaßen eine prima Hörnchentränke abgibt.
Der Beobachter soll natürlich Recht behalten. Bei uns dürfen sie das alles.
Es ist noch nicht einmal 10h, die Kunde hat Runde gemacht. Ab sofort campen die Globetrottels im Auge des Murmeltierzenits, im Zentrum des Chipmunkuniversums.
Freunde, das Buffet ist eröffnet. All you can eat.
Und heute Abend schlummern ein paar mit vollgefressenen Bäuchlein schnarchend und piepend in unserem Bettchen.
Ich bin mir einigermaßen sicher, dass es genauso kommen wird.
Dies soll nicht unsere einzige Wildlifeerfahrung für den Tag bleiben. Wir rechnen mit allem auf dem heillos überlaufenen Wanderweg hoch zu den Bertha Falls, denn ganze Horden schwererziehbarer Halbwüchsiger sind mit uns vor Ort. Scheinbar aus pädagogischen Gründen werden diese armen Pubertierchen die verbrannten Hänge von hochmotivierten Erziehern hochgeschleift.
Rotwangige 15-jährige pusten an uns vorbei, brüllen über den schmalen Trail, manche den Tränen nah: Tja Kevin. Vielleicht überlegst Du Dir das nächste Mal vorher, ob Du die heimlich geschossenen Duschbilder von der Kimberley auf Deinem Instaaccount wirlich posten willst. Jetzt: Hoch da!
Wir rechnen mit allem. Mit allem, aber nicht damit…
14h. Wir sind bereits fast am Ende des 8km langen Wanderwegs – 300 Meter vom Magicbus entfernt, das Camp in greifbarer Nähe und plötzlich sehen wir ihn:
Nur 20 Meter vom Trail entfernt, eine Böschung tiefer, sitzt ein ausgewachsener Schwarzbär und zerlegt mit knackenden Beiß- und Schmatzgeräuschen genüsslich ein Reh. Bestimmt eines von den halbwüchsigen, die mich gestern beim Abendspaziergang den See entlang begleitet haben.
Unverhofft und unerwartet, ist es so faszinierend, dass man kaum wegschauen kann.
Es dauert eigentlich einen Moment zu lang zu realisieren, dass wir hier nicht im Zoo sind – und der Bär in keinem Gehege.
Es dauert eigentlich einen Moment zu lang zu verstehen, dass 20 Meter eindeutig zu nah sind, dass 20 Meter von einem ausgewachsenen Schwarzbären sehr flott überwunden werden können, wenn er das wünscht.
Es macht sehr viel Sinn, sehr zügig zu verstehen, dass es aller äußerst viel Sinn macht, jetzt ruhig und besonnen weiter zu gehen. Sofort! Bevor der Bär noch meint, wir wollten ihm seine Beute streitig machen. Bevor der Bär merkt, dass eine Ebene höher bräsige Globetrottels paralysiert auf abgenagte Rehbeinchen starren. Bevor der Bär realisiert, dass dort ein sehr leicht zu erlegendes Abendessen steht und gafft.
Freunde, das Buffet ist eröffnet. All you can eat…
Ehrfürchtig, atemlos, fasziniert, alarmiert, sehr demütig und sehr dankbar für eine unvergessliche Erfahrung erreichen wir ruhigen Schrittes den Magicbus. Um danach innerlich auszuflippen.
Wir Menschen sind schon sehr kleine und manchmal auch sehr dumme Tierchen. Und in der Fresskette nicht unbedingt oben. Das sollte man sich ruhig manchmal klar machen. Vor allem in Gegenden wie diesen…
Freunde, das Buffet ist eröffnet. All you can eat.
Wie schön, dass ich das noch schreiben kann, um danach die Murmeltierchen mit vollen Bäuchlein ins Bettchen zu bringen, wo sie heute Nacht piepend schnarchen und friedlich schlafen dürfen.